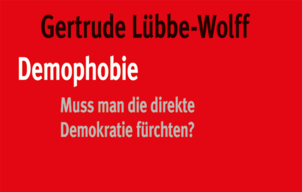Das Buch setzt sich kritisch mit der weit verbreiteten Skepsis gegenüber der direkten Demokratie auseinander und plädiert differenziert für deren Ausbau als sinnvolle Ergänzung zur repräsentativen Demokratie.
Die Autorin widmet sich zehn typischen Vorbehalten, die sich gegen direkte Volksentscheide richten. Dazu zählen Zweifel an der Urteilsfähigkeit der Bevölkerung, die Gefahr einseitiger oder von Emotionen getriebener Entscheidungen, mangelnde Verantwortung für komplexe Sachfragen und fehlende Kompromissfähigkeit durch Ja-Nein-Entscheidungen. Lübbe-Wolff analysiert diese Argumente kritisch.
Das Werk ist nicht nur ein Beitrag zur Demokratie- und Staatsrechtslehre, sondern auch ein engagiertes Plädoyer für rational geführte Debatten über die Weiterentwicklung demokratischer Verfahren. Lübbe-Wolff fordert eine nüchterne, differenzierte und sachbezogene Diskussion statt reflexartiger Angst vor direkter Bürgerbeteiligung und empfiehlt, die Potenziale der direkten Demokratie verantwortungsvoll zu nutzen.
Gertrude Lübbe-Wolff: Demophobie. Muss man die direkte Demokratie fürchten?
Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann GmbH 2023
212 Seiten, 24,80
Hier eine knappe Zusammenfassung des Inhalts:
I Einführung
I Einführung
Für Volksentscheide auf Bundesebene:
- SPD 2007 (Grundsatzprogramm)
- Grüne 2017 (Wahlprogramm)
- FDP 2012 (Grundsatzprogramm)
- CSU 2017 (Wahlprogramm; etwas indirekt formuliert)
- 2021: nichts davon übrig geblieben
Gründe dafür sind wohl:
- Brexit Votum 2016
- Trump Wahlsieg 2016, AfD-Erfolge, Orban, Erdogan
II Vorbehalte gegen direktdemokratische Entscheidungen
1. Für Sachentscheidungen ist das Volk zu dumm
- In der Regel wird die Wahl der Repräsentanten unproblematisch gesehen. Aber erfordert die Wahl der Repräsentanten weniger Klugheit als eine Abstimmung zu einer Sachfrage? Wäre es weniger schlimm, Autokraten an die Macht zu bringen, als eine Rentenfrage „falsch“ abzustimmen?
- Die Schweizer finden Wählen (Personen) schwieriger als Abstimmen (Sachfragen)
- Selbstbestimmung ist ein Wert an sich, führt zu Zufriedenheit und Vertrauen in das politische System.
- Vor Abstimmungen informieren sich die Bürger zu den Sachthemen, was viele positive Folgewirkungen hat.
- Generell: Vieles hängt von der Ausgestaltung der direkten Demokratie ab, aber dazu gibt es genügend Erfahrungen
- Natürlich sind schlechte Entscheidungen auch möglich, aber Entscheidungen von Repräsentanten sind auch nicht immer ideal. Vorsicht: Idealvergleichsfehler – eine reale direkte Demokratie mit einer idealen Repräsentantendemokratie zu vergleichen sagt nichts aus, und anders herum.
2. Direkte Demokratie begünstigt Demagogen
- Nach dem Dritten Reich war es für die Eliten entlastend, die Verantwortung dafür beim Volk zu sehen. Stichwort „Schlechte Erfahrungen der Weimarer Republik“
- Oft wird bei diesem Argument der Begriff „plebiszitär“ unscharf benutzt, um Volksabstimmungen allgemein in ein schlechtes Licht zu rücken.
- Die NSDAP ist im Modus der repräsentativen Demokratie stärkste Partei geworden, und ebenso Hitler Reichskanzler.
- Das Ermächtigungsgesetz wurde von den gewählten Repräsentanten beschlossen, nicht vom Volk.
- Es ging bei der Machtergreifung nicht legal zu, aber auch nicht direktdemokratisch
- Während der Weimarer Republik gab es nur 3 weiter gediehene Volksbegehren, die aber alle an Quoren scheiterten.
- Nach der (illegalen) Machtergreifung (also in der Diktatur) gab es mehrere Volksabstimmungen, aber nicht nach Weimarer Recht, sondern nach einem neuen nationalsozialistischen Gesetz. Die Initiative war nur der Regierung möglich, und gleichzeitig war auch nur eine zustimmende Abstimmung bindend.
- Von Regierung oder Präsidenten angesetzte Abstimmungen (Plebiszit im engeren Sinne) stärken in der Regel die Regierung, und sind beliebt in weniger demokratischen Staaten. Sie sind auch als zusätzliches Mittel nicht wünschenswert
3. Vor allem in Finanzfragen ist dem Volk nichts zuzutrauen
- Warum sollte das Volk hierbei schlechter entscheiden als die Repräsentanten? Dort gibt es Klientelbedienung, wechselseitige Koalitionskonzessionen, Ausgabenkarussell durch wechselnde Mehrheiten.
- Untersuchungen der Schweiz (Kantone und Bundesebene) sowie USA zeigen: Ausgaben und Schulden sind geringer bei mehr direkter Demokratie. Hauptsächlich durch Referenden (Veto gegen repräsentativ beschlossene Ausgaben).
4. Das Volk wird rechtslastige / linkslastige / unedle Entscheidungen treffen
- Man muss unterscheiden:
- a) Status-Quo erhaltende Wirkungen
- b) Verschiebungen nach rechts, links, …
- Zu a) Status-Quo erhaltende Wirkungen:
- Die Mehrzahl der schweizer Initiativen (vom Volk vorgeschlagene Gesetze) wird abgelehnt. Aber einige eben nicht, und das spricht gegen die Behauptung (dass der Status Quo durch die Möglichkeit von Volksabstimmungen erhalten wird).
- Auch bei Ablehnung gibt es oft indirekte Wirkungen.
- (Bis 1987 hatte die Schweizer Regierung die Möglichkeit, mit einem Gegenentwurf die gegnerische Mehrheit zu spalten und dadurch mit einer Minderheit der Stimmen zu gewinnen– schlechte Gestaltung der direkten Demokratie, jetzt verbessert).
- Fakultative Referenden d.h. Vetos gegen erlassene Gesetze, werden ebenfalls meist abgelehnt, und haben ebenfalls indirekte Wirkungen.
- Es dauert zwar länger bis zur finalen Entscheidung, aber dafür haben die Entscheidungen eine bessere Qualität und bei der Umsetzung mehr Verständnis und Unterstützung der Bürger.
- „Reformparteien“ werden vermutlich eher in einer Demokratie gewählt, in der die Bürger eine „Bremsmöglichkeit“ durch Fakultative Referenden haben.
- Zu b): Verschiebungen nach rechts, links, usw. werden oft die folgenden Beispiele genannt:
- Die Blockade des Frauenstimmrechts in der Schweiz bis 1971. Grund ist vermutlich einfach: Macht abzugeben fällt schwer. Von diesem Einzelfall lässt sich aber nicht verallgemeiner, dass z.B. einseitig rechte Politik begünstigt wird.
- Der Brexit. Dies war rechtlich eine unverbindliche Volksbefragung, von oben initiiert aus taktischen Gründen. Es gab grobe Fehlinformationen durch Amtsträger. Vor allem war der Abstimmungsgegenstand gar nicht klar (weil erst konkretisiert durch die später erfolgenden Austrittsverhandlungen mit der EU), und es gab vor allem keine Korrekturmöglichkeit für den Zeitpunkt nach den Austrittsverhandlungen. Außerdem war es erst die 3. Abstimmung in der Geschichte Großbritanniens, was sicher zu „überschießendem Protest“ beigetragen hat.
- Letztes Beispiel: Schweizer Initiative für Minarettverbot und mehrere Einwanderungsinitiativen. Diese Abstimmungen kann man unschön finden, sie sind aber nicht dramatisch, vor allem vor dem Hintergrund eines mit 25% sehr hohen Ausländeranteils an der Wohnbevölkerung, und vorbildlichen Integrationsleistungen im Vergleich zu anderen Ländern.
- Bei der Globalisierung (wozu das Migrationsthema gehört) sind Bürger naturgemäß skeptischer als ihre Eliten. Gegen Populismus und mangelndes Vertrauen gegenüber der Politik hilft die Möglichkeit von (sinnvoll ausgestalteten) Volksabstimmungen.
- Oft wird behauptet, die Repräsentanten könnten irgendwie einen „veredelten“ Volkswillen hervorbringen. Ein krasses Gegenbeispiel dafür ist aber zum Beispiel die wünschenswerte Verkleinerung des Deutschen Bundestages, der die Repräsentanten jahrelang ausgewichen sind (im Unterschied zu Italien, wo sie 2020 mit einer Volksabstimmung bei 70% Mehrheit beschlossen wurde).
5. Direkte Demokratie ist unsozial
- Argument: Die Beteiligung bei Abstimmungen ist geringer als bei Wahlen, und sozial unausgewogener (die weniger gebildeten und einkommensschwächeren Schichten beteiligen sich weniger), daher führt dies zu einer unsozialeren Politik.
- Aber macht es Sinn, eine an sich sinnvolle und für alle kostenlose Einrichtung nicht anzubieten, weil sie von einigen Bevölkerungsgruppen weniger genutzt wird? Besser ist, die Beteiligung durch bessere politische Bildung zu erhöhen – und genau das bewirkt die Direkte Demokratie.
- Bei den gewählten Repräsentanten ist der Anteil der entsprechenden Schichten sehr gering.
- Faktoren die zu einer niedrigeren Beteiligung bei Abstimmungen beitragen:
- Höherer Aufwand je nach Ausgestaltung, z.B. durch fehlende Briefwahlmöglichkeit, oder weil zu viele Abstimmungen gleichzeitig auf dem Zettel stehen.
- Umgekehrt: wenn die Beteiligung sich aus subjektiver Sicht nicht „lohnt“, weil das Ergebnis (durch Umfragen oder wegen Quoren) schon klar ist, sinkt die Beteiligung.
- Diese Fälle verringern die durchschnittliche Beteiligung. Bei Wahlen hingegen „lohnt“ sich die Beteiligung immer (außer bei Mehrheitswahlrecht wie in den USA).
- Wie schon mehrfach gesagt: nur weil eine schlechte Ausgestaltung denkbar ist, sollte eine an sich gute Einrichtung nicht abgelehnt werden.
- Der Anteil der Bürger, die mindestens gelegentlich ihre Stimme abgeben, liegt bei Abstimmungen weit höher als bei Wahlen.
- Empirische Auswirkungen der direkten Demokratie:
- Öffentliche Mittel werden um so effizienter ausgegeben, je mehr direkte Demokratie es gibt.
- Die Steuermoral steigt bei mehr direkter Demokratie – ein sehr sozialer Effekt
- Es gibt eine Korrelation: Mehr direkte Demokratie – weniger ungleiche Einkommensverteilung (Kausalität lässt sich nicht leicht nachweisen).
- Die Schweiz hat in vieler Hinsicht eine sozialere Politik als Deutschland: kleinerer Anteil des Niedriglohnsektors, keine Beitragsbemessungsgrenze bei Sozialsystemen, keine kalte Progression, wesentlich niedrigere Umsatzsteuer.
- Die Hamburger Initiative „Wir wollen lernen“ 2010 wird oft als Beispiel für unsoziale Effekte genannt:
- Man kann darüber streiten, ob es dabei nur um Interessen reicherer gegen ärmere Schichten ging.
- Repräsentative Politik kommt ganz überwiegend zu dem gleichen Ergebnis (4 Jahre Grundschule).
- Es gab eine spezielle Vorgeschichte: der CDU-Spitzenmann hatte das Gesetz mit der SPD durchgesetzt, entgegen großer Teile seiner eigenen Partei.
- Gibt es einen Einfluß des „großen Geldes“ (finanzstarke Akteure)?
- Es stimmt: Wirtschaftsverbände setzenbei Abstimmungen die größten Geldmittel zur Werbung ein. Und rechte Parteien setzen mehr Geld ein als linke.
- Das Problem ist aber nicht übermäßig groß, gestaltbar, und in jedem Fall kleiner als bei der repräsentativen Demokratie:
- Lobbying, Mitarbeit bei oder sogar Erstellung von Gesetzesentwürfen, direkte oder indirekte Finanzierung z.B. durch Beraterhonorare, und finanziell attraktive Beschäftigungen nach Ausscheiden aus der Politik.
- Wohl darum wird die direkte Demokratie von Wirtschaftsverbänden immer abgelehnt.
- Es hängt wieder von der Ausgestaltung ab:
- Finanzierungstransparenz,
- Kampagnenfinanzierung aus öffentlichen Mitteln; kostenloser und gleicher Medienzugang,
- Ausgabenbegrenzung oder Spendenbegrenzung.
- Je mehr direkte Demokratie, desto niedriger das Korruptionsniveau.
6. Ja/Nein-Entscheidungen sind zu simpel und kompromisswidrig
- Auch bei der repräsentativen Demokratie steht am Ende eine Ja/Nein Entscheidung
- Im Ideal der repräsentativen Demokratie kommt die Entscheidungsvorlage aus der Diskussion des Parlaments, aber in der Realität gibt es Koalitionsverträge, informelle internationale Absprachen, Fraktionsdisziplin.
- Bei der direkten Demokratie hängt es wieder von der Ausgestaltung ab.
- Bei Volksinitiativen gibt es bis zur Einreichung viel mehr Diskussion und Kompromiss, da es eben keinen Fraktionszwang oder Ähnliches gibt.
- Je nach Ausgestaltung kann das Parlement einen Gegenvorschlag machen.
- In sehr vielen Fällen gibt es schon vor der Abstimmung von den Repräsentanten einen „indirekten Gegenvorschlag“ in Form einer weniger radikalen Regelung, und oft wird die Initiative dann aufgegeben.
- In der Schweiz gibt es oft auch bei knapp abgelehnten Initiativen eine Regelung in Richtung der Initiative.
- Außerdem begünstigt schon die Möglichkeit von Initiativen eine stärkere Kompromisskultur der repräsentativen Demokratie („Konkordanzdemokratie“).
- In den USA gibt es aus rechtlichen und kulturellen Gründen wenig Dialog und Kompromiss bei Abstimmungen.
- Top-Down Abstimmungen (Brexit) sind natürlich genau nicht kompromissfördernd.
7. Direkte Demokratie gefährdet Minderheiten
- Verwandt mit Punkt 6
- Initiativen bieten (bei sinnvoller Ausgestaltung der direkten Demokratie) Minderheiten die Möglichkeit, auf sich aufmerksam zu machen, und eine öffentliche Diskussion anzustoßen. Zusätzlich gibt es indirekte Wirkungen.
- In den USA gingen Abstimmungen häufiger zu Lasten von Minderheiten (z.B. busing, social housing), aber es ist sehr fraglich, ob die repräsentative Demokratie alleine hier zu besseren Ergebnissen geführt hätte (z.B. wuchs die Sklaverei auf dem Boden der repräsentativen Demokratie in der USA).
- In der Schweiz ist aufgrund der kompromissorientierteren Ausgestaltung die Bilanz wesentlich besser.
- In rechtsstaatlichen Demokratien werden Minderheiten durch Grundrechte und Verfassungsregeln geschützt
- In Deutschland: Verfassungsgericht, EU Menschenrechtskonvention
- In der Schweiz gibt es als Sonderfall keine explizite Verfassungsprüfung, aber das Bundesgericht kann dies in der Regel durch Auslegung kompensieren.
8. Direkte Demokratie passt nur zu kleinen Einheiten
- Dieses Argument wird meist unsachlich benutzt.
- Mit Bezug auf Volksentscheide in öffentlicher Versammlung, die es in der Schweiz vereinzelt noch gibt
- oder mit Bezug auf das Bild einer „verführbaren Masse“
- Allgemein hat eine rechtsstaatliche Demokratie (egal ob rein repräsentativ oder auch direktdemokratisch) einen hohen Institutionalisierungsbedarf, um Willkür zu verhindern.
9. Direkte Demokratie passt nicht zur repräsentativen
- Tendenziell erhöht direkte Demokratie die Responsivität der repräsentativen.
- Es tritt auch keine allgemeine Schwächung der Parteien ein, sondern die jeweils regierende Partei wird etwas geschwächt, die Opposition etwas gestärkt.
- Wegen der Möglichkeit von Sachentscheidungen sinkt die Bedeutung von Wahlen.
- Das Verhältnis von repräsentativer zu direkter Demokratie muss sinnvoll ausgestaltet werden, hierzu gibt es Erfahrungen.
10. Es fehlt an Verantwortung
- Ein kurioser Vorwurf.
- Bei repräsentativer Demokratie kann der Entscheider nur indirekt bei der nächsten Wahl (wenn er erneut antritt) zur Verantwortung gezogen werden, bei der direkten Demokratie ist er direkt selbst betroffen.
III Vernachlässigte Argumente für direktdemokratisches Entscheiden
Zusammenfassung der bereits genannten Vorteile:
- Direktere Selbstbestimmung
- Beitrag zur politischen Bildung und Urteilskraft
- Rückwirkung auf repräsentative Demokratie
- Stärkere Orientierung am Wählerinteresse
- Stärkere Überzeugungsarbeit zu Sachthemen
- Zurückdrängen des Eigeninteresses von Repräsentanten und Parteien
- Erhöhte Zufriedenheit der Bürger mit dem politischen System gesamt, höheres Demokratievertrauen
1. Lösung des Problems der festgeschnürten Politikpakete
- Dies ist ein Problem, seitdem der starke Zusammenhang zwischen Parteien und ihren Milieus (z.B. SPD / Arbeiter, CDU / Katholiken) verschwunden ist.
- Wähler finden keine Parteien mehr, deren Gesamtpaket sie überzeugt, sondern wählen „das kleinere Übel“.
- Direkte Demokratie löst dieses Problem.
- Sie gibt den Repräsentanten Feedback, was genau die Wähler wollen.
2. Demokratisierung der auswärtigen Politik
- Bei diesem Punkt sind die Bürger besonders unzufrieden, z.B. Globalisierung und Europäisierung.
- Grund ist wohl die Exekutivlastigkeit der auswärtigen Politik.
- Mit direkter Demokratie verlangsamt sich die internationale Integration, es gibt weniger „Schocks“ für die Bürger.
3. Gegengewicht zur Kurzfristorientierung repräsentativ-demokratischer Politik
- Bei der repräsentativen Demokratie führt die Fokussierung auf den nächsten Wahltermin zur Vernachlässigung der langfristigen Perspektive.
- Bei der direkten Demokratie gibt es das Problem nicht.
4. Fehlerkorrekturfreundlichkeit
- In der repräsentativen Demokratie sind Fehlerkorrekturen unwahrscheinlich, wegen Koalitionsrücksicht und Vermeidung von Gesichtsverlust.
- Bei der direkten Demokratie gibt es das Problem nicht.